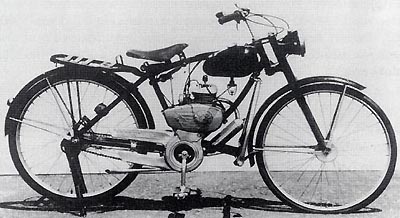|
Geschichte der japanischen Motorradindustrie
Von der Reisschale zum
Mega-Star
Als bei uns in den
sechziger Jahren die ersten japanischen
Transistorradios auf den Markt
kamen, hatten sie zunächst den
Ruf eines billigen "Wegwerfproduktes".
Auch die ersten japanischen
Motorräder wurden in diese Schublade
gesteckt. Allerdings nicht
lange. Ende der Sechziger, Anfang der
Siebziger, stellten Honda,
Yamaha, Suzuki und Kawasaki mit
außergewöhnlichen Maschinen
den Motorradmarkt weltweit auf den Kopf.
Text: Winni Scheibe
Fotos: Werks-Archive, Scheibe
|
|

Japanische Wahrzeichen: Fuji-san mit
"Shinkansen" Schnellzug
(Foto: Werks-Archiv) |
|
Diskutieren Motorradfans
über japanische Bikes, sprechen sie meist von Honda, Yamaha, Suzuki und
Kawasaki. Diese Marken kennt eigentlich jeder. Unbekannt oder vergessen
sind dagegen die weit über hundert Firmen, die es nach dem Zweiten
Weltkrieg bis in die sechziger Jahre „im Land der aufgehenden
Sonne" gab. Sie hatten die für uns schier unaussprechlichen Namen
wie Asaki, Bridgestone, Cabton, Meihatsu, Marusho, Meguro, Misima,
Mikuni, Rikuo, Riruo, Nakajima, Mitsubishi, Kawanishi, Lilac, Fuji,
Toyo-Kogyo, Miyata, Murata, Meiwa, Tohatsu, Pointer und Gasuden, um hier
nur einige zu nennen.
Im Prinzip durfte es den
Leuten außerhalb Japans aber auch egal sein. Zu kaufen gab es die
Feuerstühle nicht, die Fachpresse berichtete mit keiner Zeile über
sie, und selbst Insider wussten kaum etwas vom fernöstlichen Markt. An
ein Exportgeschäft dachte man in Japan nämlich noch lange nicht.
Dabei konnte Nippons
Motorradindustrie auf eine lange Tradition zurückblicken. Bereits Anno
1908 bastelte ein gewisser Torao Yamaba (nicht zu verwechseln mit
Yamaha!) einen gewaltigen 500 ccm Einzylinder-Viertakt-Motor an ein
Fahrrad. Genau wie in der westlichen Welt beschäftigten sich um die
Jahrhundertwende auch in Japan einfallsreiche Handwerker, Techniker und
Konstrukteure mit der Herstellung von motorisierten Zweirädern. Es
waren stinkende und qualmende Vehikel, die allerdings mehr einem Fahrrad
als einem Motorrad ähnelten. Geschlossert wurde in winzigen
Werkstätten, von Großserienbau oder gar Massenproduktion konnte
überhaupt noch keine Rede sein. An dieser Situation sollte sich bis
Anfang der fünfziger Jahre auch nichts ändern.
|
|
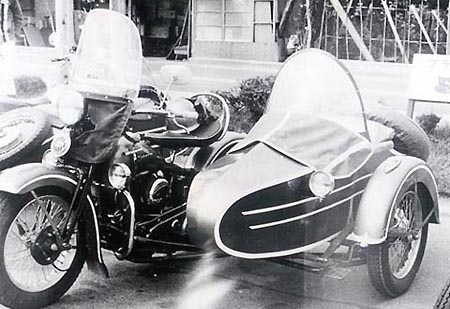
Rikuo-Gespann
(Foto:
Werks-Archiv)
|
|
Bis auf eine Ausnahme:
1912 orderte das japanische Kriegsministerium eine Harley-Davidson. Ein
folgenschwerer Kauf, wie sich bald herausstellen sollte. Der
amerikanische Hersteller witterte ein große Geschäft und vergab 1916
an den japanischen Unternehmer Nihon Yidosha einen Händlervertrag. In
den nächsten acht Jahren ließen sich die verkauften US-Bikes jedoch an
zwei Händen abzählen. Ein schlechtes Geschäft, und so entschloss sich
der Konzern aus Milwaukee/Wisconsin die Sache selbst zu organisieren.
HD-Exportmanager Alfred-Rich Child gründete 1924 eine
Werksniederlassung und baute innerhalb von nur 40 Tagen (!) ein
flächendeckendes Händlernetz auf. Zu den besten Kunden gehörten das
Militär und zahlreiche Behörden. Rund zehn Jahre lief der Handel
bombig. Anfang der dreißiger Jahre machte aber der rapide Kursverfall
des Yen die amerikanischen Maschinen um das Vierfache teurer, und sie
wurden schier unverkäuflich. Um jedoch weiterhin in den Genuss der
noblen US-Motorräder zu kommen, bemühten sich die Japaner um einen
Lizenzvertrag zum Nachbau der 750er V2-Maschinen. Harley-Davidson
willigte ein, machte allerdings zur Auflage, dass keines dieser Bikes
außerhalb des Inselreiches verkauft werden durfte. Mit amerikanischem
Know-how entstand 1934 in Shinagawa bei Tokio so das erste japanische
Motorradwerk mit dem Markennamen "Rikuo".
|
|
Schon ein Jahr später
rollten die brandneuen Rikuos, alias Harley-Davidson, vom Werksgelände.
Hauptabnehmer waren weiterhin die japanische Armee sowie etliche Staats-
und Provinzbehörden. Bis 1945 bezifferte sich der Produktionsausstoß
auf immerhin 18.000 (!) Einheiten. Die neue Firma genoss hohes Ansehen
und für viele der kleinen japanischen Motorradhersteller gehörte ein
Werksbesuch bei Rikuo zur „Pflichtlektion". Aber das nutzte
wenig. Die perfekten Harley-Kopien bestimmten das Maß der Dinge. Dank
Massenproduktion waren sie haltbar und zuverlässig. Keines der anderen
japanischen Motorräder kam an die Qualität und an die Exklusivität
der Rikuo heran.
|

Harley-Davidson "Made in
Japan" |
|

|
Privatleute, die sich
dagegen ein Bike aus den USA oder gar aus dem fernen Europa zulegen
wollten, mussten tief in die Tasche greifen. Denn die kaiserliche
Administration sah Motorfahrzeuge von den "Langnasen" im
Inselreich überhaupt nicht gern. Anfang der dreißiger Jahre beschloss
das Kabinett ein Gesetz, das den Zolltarif für Import-Motorräder
immerhin auf 700 Prozent (!) festsetzte.
|
|
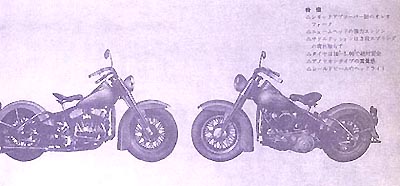
(3 Fotos: Werks-Archiv)
|
|
Doch dann kam der Zweite
Weltkrieg, und die Japaner hatten plötzlich ganz andere Sorgen. Was im
Land an Motorrädern zu haben war, wurde für die Mobilisierung
konfisziert, landauf-landab werden die Firmen mit der Produktion von
Rüstungsgütern beauftragt.
|
|

50er Honda von 1947
(Foto: Werks-Archiv) |
|
Nach Kriegsende lag Japan
- genau wie Deutschland - in Schutt und Asche. Der Wiederaufbau kam
ähnlich schnell in die Gänge, denn an allen Ecken und Enden wurden
dringend preisgünstige Transportfahrzeuge gebraucht. Zunächst waren es
kleine "Hinterhof-Werkstätten", die Fahrzeuge jeder Art
zusammenbastelten. Es wurde improvisiert, zusammengeschustert und
getrickst: ursprüngliche Motoren für Stromaggregate und Hilfsantriebe,
die in Militärfahrzeugen zum Einsatz kamen, wurden zu Mopedtriebwerken
umgemodelt. Als Rahmen dienten in den meisten Fällen "modifizierte"
Fahrradgestelle.
|
|
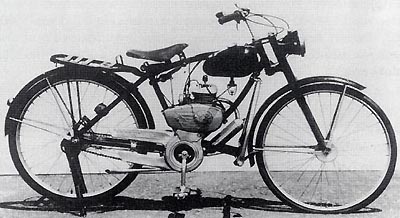
Fahrrad mit Hilfsmotor
(Foto:
Werks-Archiv)
|
|
Aber auch die
Großindustrie stieg ins Moped- und Motorradgeschäft ein. Nach dem
Diktat der alliierten Siegermächte durften diese Firmen nämlich keine
Flugzeuge mehr bauen, und so nutzte man die verbliebenen
Produktionsstätten für die Fertigung von Mopeds, Rollern und
Leichtmotorrädern.
|
|
Bei Rikuo baute man bald
wieder die Harley-Kopie, und Meguro ließ die Vorkriegs-500er aufleben.
Die zerstörte Industrie, so makaber es auch klingen mag, wurde Japans
wirtschaftliches Glück. Man investierte auf "Teufel komm
heraus", überall entstanden neue Fabriken. Die erforderlichen
Werkzeugmaschinen wurden großteils in den USA oder Europa gekauft. Und
so wunderte es nicht, dass es allein in der Moped- und Motorradbranche
bald weit über hundert Firmchen und Firmen gab.
|
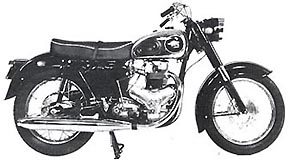
500er Meguro (fast wie eine BSA A7) |
|
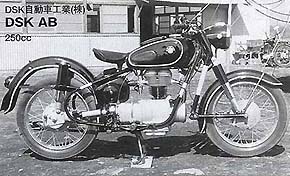
DSK 250 (fast wie eine 250er BMW) |
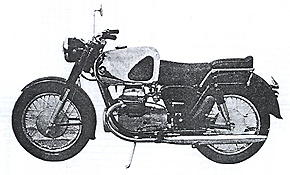
Lilac (fast wie eine Bergmeister) |
|
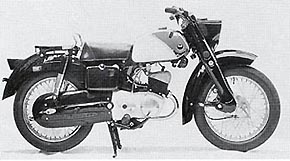
Meihatsu 125 von 1969 |

Suzuki Power Free 36 ccm von 1953
(5 Fotos: Werks-Archiv)
|
|
Zunächst galt es
allerdings, den eigenen Markt zu versorgen. Wer pünktlich zur Arbeit,
ins Büro oder zur Schule kommen wollte, musste nämlich mobil sein. Die
Infrastruktur war fast überall zerstört, dazu machten verstopfte
Straßen, Benzinknappheit und Geldmangel ein flottes Vorwärtskommen von
A nach B in vielen Fällen zur Tortur. Das einzig brauchbare und
erschwingliche motorisierte Fahrzeug war eben ein Fahrrad mit Hilfsmotor
oder ein preiswertes Leichtmotorrad.
Die Nachfrage nach diesen "Feuerstühlen" war gewaltig und der Traum vom eigenen Auto noch
meilenweit entfernt. Und so blieben Mopeds und Motorräder zunächst im
Land, denn bei dieser starken Inlandsnachfrage dachte noch niemand ans
Exportgeschäft. Bereits Mitte der fünfziger Jahre betrug die
Jahresproduktion über 200.000 Einheiten, Tendenz steigend.
|
|

DSK 500
(könnte auch BMW auf dem Tank stehen) |

Marusho 500 (oder doch eine BMW?) |
|
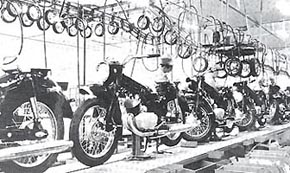
Motorradproduktion in den 50er Jahren
(4 Fotos: Werks-Archiv) |
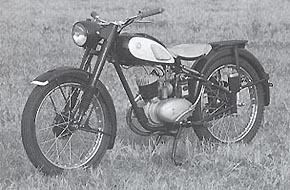
Yamaha YA1 von 1955
(DKW RT 125 Nachbau)
|
|
An ein ausländisches
Motorrad war dagegen allerdings kaum zu denken. Damit die Bevölkerung
nämlich treu und brav Produkte "made in Japan" kaufte, hatte die
Regierung in Tokio, ähnlich wie bereits in den dreißiger Jahren, ein
Wirrwarr von Gesetzen, Verordnungen, Einfuhrzöllen und strengen
Devisenbestimmungen erlassen. Diese kaum überwindbaren Importbarrieren
waren zum Schutz für die eigene Wirtschaft verhängt worden. Allerdings
mit einer Ausnahme: Benötigte ein heimischer Hersteller für „Studienzwecke"
dieses oder jenes Modell, entwickelte der Behördenapparat urplötzlich
eine erstaunliche Aktivität. Nicht selten übernahm das jeweils
zuständige Ministerium sogar sämtliche Kosten für die Beschaffung des
Objektes. Beste Beispiele für diese "Kopien" sind die Meguro
500-Twin K1 "Stamina", als Vorbild diente die BSA A7; die Lilac,
hier stand die Victoria V 35 Bergmeister Pate; bei der Cabton 500
bediente man sich des Indian-Twins zum Abkupfern; Yamahas erster
Zweitakthüpfer YA1 war eine haargenaue Nachbildung der DKW RT 125 und die 500er Marusho war
im Prinzip eine japanische BMW R 51/3...
|
|
Aber längst nicht bei
allen Firmen wurde frech kopiert. Bridgestone, bereits Anfang der
fünfziger Jahre zehntgrößter Reifenhersteller der Welt, entwickelte
zum Beispiel 1958 ein modernes Leichtmotorrad mit 90 ccm
Einzylinder-Zweitakt-Drehschieber-Motor. Auch die späteren 250er und
350er Zweitakt-Twins wurden über Drehschieber gesteuert und hatten
bereits eine Getrenntschmierung.
|
 |
|

Honda-san |

Yamaha-san |

Suzuki-san
(3 Fotos: Werks-Archiv) |
|
|
Der mit Abstand
erfolgreichste Mann in der japanischen Motorradindustrie sollte Soichiro
Honda werden. Schon Anfang der fünfziger Jahre unternahm der agile
Firmenboss Geschäftsreisen in die USA und nach Europa. Dort kaufte er
für rund eine Million US-Dollar die besten Werkzeugmaschinen, die auf
dem Markt zu haben waren. Bei diesen "Shoppingtouren" besuchte
Honda-san auch die großen Motorradwerke in den jeweiligen Ländern und
ließ sich bis ins kleinste Detail die technischen Finessen erklären.
Besonders beeindruckt war der clevere Unternehmer vom NSU-Werk in
Neckarsulm, dem NSU-Rennstall und den hochtourigen DOHC-Rennmotoren des
in dieser Zeit weltgrößten Zweiradproduzenten. Auch Soichiro Honda
ließ sich bei einigen seiner Modelle von NSU inspirieren. Hinter Honda
war Meguro zweitgrößter japanischer Motorradhersteller. Dieses Werk
produzierte bereits in den dreißiger Jahren robuste und zuverlässige
Motorräder.
Ende 1959 stellte Meguro
den neuen 500-Twin K1 "Stamina" - besagte BSA-Kopie - vor, es
war, abgesehen von der Rikuo, immerhin das erste eigene Big-Bike auf dem
japanischen Markt!
In den Fünfzigern gab es
im Nippon-Land fast an jeder Ecke eine Firma, die in oder für die
Motorradbranche tätig war. Viele Manufakturen bauten allerdings nur
Fahrgestelle. Den erforderlichen Motor und alle weiteren Teile bezog man
von Zulieferfirmen. Andere hatten sich auf die Fertigung von
Triebwerken, wiederum andere auf die Herstellung von Zubehör
spezialisiert. Das Geschäft brummte, Arbeit gab es ohne Ende. Doch so
schnell die vielen Motorradfirmen und Zubehörhersteller auf der
Bildfläche erschienen waren, so schnell waren sie auch wieder
verschwunden. Auch in Japan änderten sich mit wachsendem Wohlstand die
Ansprüche an den fahrbaren Untersatz. Motorräder waren nur solange
interessant, solange man sich eben noch kein Auto leisten konnte.
|
|
"Brenner für die Neuzeit"
|
|
Lediglich vier Marken
haben den Sprung in die Neuzeit geschafft: Honda, Yamaha, Suzuki und
Kawasaki. Ohne sie wäre allerdings der nächste weltweite
Nachkriegs-Zweiradboom auch kaum möglich gewesen. Nachdem die
Kundschaft im eigenen Land versorgt war, eroberte Nippon den
amerikanischen Markt, wenig später war Europa an der Reihe. Im
Vergleich zu den westlichen Maschinen waren die japanischen Bikes frech,
pfiffig, schrill, schnell und stark.
|
|

Meilenstein: Honda CB 750 Four von 1969
|
|

Yamaha R1
|
|

Suzuki GSX 1100 Katana
|
|

Kawasaki Z 1300 |
|
Längst
waren es keine "Brot-und-Butter-Motorräder",
sondern Maschinen
für den Fahrspaß, Sport und für die Freizeit.
|